Teil II - Die Verwendungsbreite der Prostitution als Hürde zur digitalen Transformation
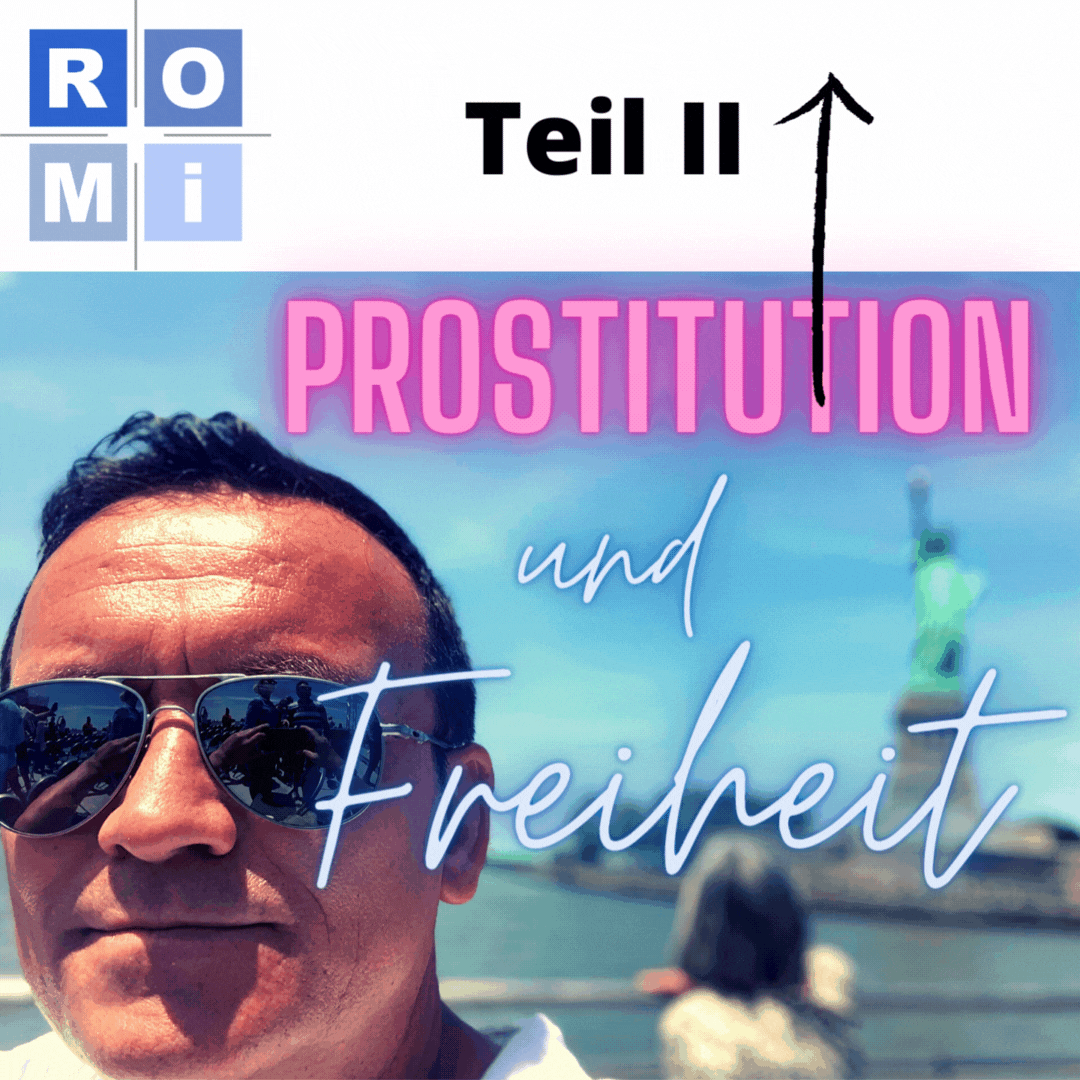
Wie wir und was wir arbeiten verändert unsere Welt, jedoch haben demgegenüber nur die wenigsten eine Kontrolle über die Ziele, Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser Arbeit. Während wir arbeiten, nutzen wir unsere Zeit und Kreativität, um Ziele, die andere bestimmen, zu verfolgen. Die Entscheidungen, die Experten bei ihrer Arbeit treffen, haben einen viel größeren Einfluss auf die Gesellschaft, als die Entscheidungen, die sie alle vier Jahre bei der Wahl treffen.
Wenn Sie das Leben von vielen Menschen betrachten, werden Sie feststellen, dass ihre Arbeit ihr wichtigstes Projekt ist. Wie viele Projekte gibt es, für die Sie mindestens acht Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche und … investieren? Man verkauft die besten Stunden und das größte Projekt seines Lebens oder zumindest die Chance, dieses Potentials. Damit verkaufen Sie die größte Interaktion mit der Gesellschaft.
Werden Experten wissentlich so aufgebaut, dass diese sich intellektuell und politisch unterordnen? Das Unterscheidungsmerkmal bei der Qualifizierung von Experten ist ihre Bereitswilligkeit und Fähigkeit, bei ihrer Arbeit ideologisch angepasst und diszipliniert zu sein. Aber wie viele nicht systemangepasste Experten haben das Potential für die Qualifizierung.
Es sind vermutlich sehr viele.
Die nicht systemangepassten Experten werden einem Prozess untergeordnet. Dieser Prozess enthält alle Situationen, die auftreten können. Demgegenüber dürfen qualifizierten Experten wesentlich kreativer arbeiten. Betrachten Sie als Beispiel einen Journalisten. Er oder Sie bekommt keine Vorgaben, die ihr oder ihm auch nur das erste Wort einer Story sagt. Jedoch geben Arbeitgeber ihren Experten die Ideologie vor, und dann führt der Experte kreative Arbeit aus, unter der Führung der vorgeschriebenen Ideologie.
Grundsatz: Experten arbeiten gestalterisch in dem Rahmen, der von ihrem Arbeitgeber vorgegeben wird.
Lehrer bekommen zum Beispiel Preise dafür, neue und innovative Wege zu finden, wie man den Schülern den Stoff näherbringen kann. Aber wer gibt die Lerninhalte vor? Die Arbeit von Lehrern ist kreativ, jedoch die politische Kontrolle über diese Arbeit wurde ihnen entzogen. So auch die Perspektiven eines Journalisten bei einer Story, oder wie ein Historiker ein Ereignis darstellt, oder die Entscheidung eines Buchhalters, oder die Sprache eines Anwalts in einem Vertrag oder bei einer Diskussion, die Predigt eines Pfarrers, der Unterricht eines Lehrers, sogar der Witz eines Redenschreibers, alle haben eine bestimmte Disposition und diese ist nie zufällig.
Bei jedem Beruf, wenn man erst mal damit angefangen hat, und ihn motiviert anpacken will, passiert es leicht, dass man vereinnahmt wird vom Alltagsleben und den pragmatischen Pflichten des Jobs. Hierbei verliert man auch sehr schnell den notwendigen Abstand und sieht am Ende den größeren Zusammenhang nicht mehr.
Betrachten Sie den Journalisten. Ihm wird beigebracht, wie man Storys und Perspektiven auswählt und Storys letztendlich so schreibt, dass man viele Zeitungen verkauft. Für die meisten Journalisten ist das eine Tatsache. So denken sie, dass es beim Journalismus letztendlich darum geht. Manche von Ihnen arbeiten in diesem Nebel über Jahre hinweg, bevor sie Abstand nehmen und nachdenken. Ihre Motivation ist eigentlich Journalist zu sein und kein Verkäufer. Wenn ein Journalist über so wichtige Dinge entscheidet, wie, worüber er schreiben soll, aus welcher Perspektive, wie ausführlich, auf welcher Seite und in welcher Sprache, wenn er oder sie solche Entscheidungen aus Profitgründen fällen, dann werden sie den journalistischen Ethik- und Moral-Prinzipien nicht gerecht. Bei den journalistischen Prinzipien geht es nicht um Profit, sondern es geht vor allen um Moral.
Quelle: Buch „Disciplined Minds“ (Jeff Schmidt – Physiker); Newsletter vom Lawrence Livemore National Laboratory’s (LLNL’s) National Ignition Facility (NIF) über einem der zwei Entwicklungslabore für Atomwaffen in den USA. Ein Interviewer fragte junge Atomwaffenentwickler: „Was ist das Schlimmste an Ihrer Arbeit?“ Nach kurzem Überlegen antworteten diese: „Oh, die Computer. Sie haben nicht genug Speicherplatz und stürzen immer wieder ab.“
Sind diese begrenzten Aussagen nicht eine gute Veranschaulichung für die Verblendung von Experten? Weder ihre Aufgabe noch ihr Interesse, ist es, das große Ganze infrage zu stellen oder darüber nachzudenken, ob das Schlimmste an dieser Arbeit, die Beteiligung am Bau einer Massenvernichtungswaffe und die Vorbereitung einer Katastrophe ist, die dazu beiträgt, die Welt, in der wir leben, zu einem gefährlicheren Ort zu machen. Darüber haben die jungen Experten kaum nachgedacht, weil es generell nicht zur Arbeit dazugehört, die Ziele in Frage zu stellen. Dieser Teil würde als nicht legitim betrachtet und möglicherweise sanktioniert werden, weil dem Arbeitnehmer nicht zusteht, die Moral ihrer Arbeitgeber infrage zu stellen.
„Passive Akzeptanz der Weisheit von Lehrern ist für die meisten Kinder leicht. Man muss dazu nicht unabhängig denken. Jedoch wird passive Akzeptanz im weiteren Verlauf des Lebens desaströse Konsequenzen haben. Es bringt die Menschen dazu, alle als Führer zu akzeptieren, die sich diese Position zu eigen machen.“ (Bertrand Russel)
Wussten Sie schon als Kind, was Sie einmal werden wollten?
Wer oder was war ihre Inspiration? Eventuell sind Sie sogar dieser Motivation gefolgt und fügten sich in ihre Arbeit stolz und selbstgefällig ein. Was ist jedoch mit der Reflexion ihrer Arbeit? Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, welche Konsequenzen ihre Arbeit auf andere und / oder sich selbst haben kann? Weiß zum Beispiel der Nuklearforscher, was nukleare Strahlung dem menschlichen Körper antun kann? Wenn er oder sie sich nicht mit einem spezialisierten Mediziner austauscht, dann hat er oder sie zwar die womöglich beste Ausbildung in der Nuklearphysik genossen, jedoch kaum eine Ahnung davon, welche Gefahren die nukleare Strahlung in und mit sich trägt. Der Fokus auf einseitige Wissenschaften erzeugt blinde Flecken. Deshalb ist es enorm wichtig, dass mit der einseitigen Wissenschaft ein umfassendes Verständnis für das Ganze einhergeht. Konrad Zuse - der Erfinder des Computers – hatte dieses Dilemma sinngemäß in etwa so zusammengefasst: „Das Ganze ist die Summe seiner Teile, jedoch die Summe aller Teile ergibt nicht das Ganze.“ Diese Aussage verwirrt weniger, wenn davon ausgegangen wird, dass das Leben und Lernen einem übergeordneten Sinn folgt. Mit dieser Erkenntnis hat das Gesamte (WIR) eine Logik in der Aufgabe und demgegenüber haben die einzelnen Teile (ICH) die Aufgabe, sinnvoll an sich zu arbeiten, um sich in das Ganze (WIR) einzubringen. Konrad Zuse warnt im Rahmen der technologischen Entwicklung weiter: „Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer.“ Hierbei bezieht er sich hauptsächlich auf die „Programmierung“, und die damit einhergehende Gefahr der Kontrolle durch eine Obrigkeit oder einem System - Dystopie. In dieser Zeit wurde das Verständnis für künstliche Intelligenzen und ihr Sinn für die Entwicklung des Ganzen geboren. Hierbei ergibt sich die Aufgabenstellung für diese Technologie, dass Potential von Menschen zu suchen, zu finden, zu fördern und zu verbinden für eine Zukunft des Ganzen (Leben + Lernen + Teilen + Erschaffen/Erneuern = Zukunft = Leben + Lernen + Teilen + Erschaffen/Erneuern). Wem das an dieser Stelle zu mathematisch erscheint, dem wird der Sinn bildlicher erscheinen, wenn diese Zukunft mit der Suche nach der Emotion Freude (Glück) verbunden wird.
Aktuell funktionieren immer mehr Vorgänge nur noch, wenn diese digital gesteuert werden. Prozesse werden über bisherige Arbeitserfahrungen gebildet und jeder möglichen Umgebung zugeordnet und wenn ein Fehler auftaucht, dann ist es entweder ein sogenannter Computerfehler oder ein Eingabefehler. Die Mehrheit der Menschen passt sich diesen Systemen an, weil es die neue Vergleichsebene der scheinbaren Perfektion geworden ist. Diese führt zu einer stetigen Rationalisierung menschlicher Arbeitsabläufe. Gleichzeitig führt diese Einstellung auch zur Rationalisierung von Arbeitsplätzen, so wie insbesondere die ältere Generation sie heute noch kennt. Wenn in der Bewertung - ob etwas gut und richtig oder nicht gut und falsch ist - die individuelle Motivation, Kreativität, Empathie und das Freiheitsstreben verloren gehen, dann hat das unweigerlich den Verlust der menschlichen Hauptwerte zur Folge. Menschen können und sollten auch nicht danach streben, zu Computern werden zu wollen. Wenn Menschen sich in diesem Sinne anpassen, so machen sie sich zu einer Art Sklaven von technologischen Systemen. Das wird immer deutlicher, wenn Sie das momentane Dilemma der Meinungshoheit in der sogenannten Informationsgesellschaft betrachten. Es wird eine der grundlegendesten Aufgaben in der Zukunft sein, die Seriosität der Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne dabei die individuelle Motivation, Kreativität, Empathie und das Freiheitsstreben der Menschen einzuschränken. Unser aktueller Blick auf die Gesamtentwicklung ist sehr beschränkt, insbesondere, weil der Fokus abgetrennt wurde. Einzelne Teile der Gesellschaft werden mit der Aussicht auf einen kurzfristigen Profit gelenkt. Wodurch die Konsequenzen von einzelnen Handlungen und die Priorität für die gesamte Entwicklung vernebelt wird. Die Aufgabe, die sich daraus ergibt, ist, der Fokus der einzelnen Teile auf die Gesamtverantwortung für die Zukunft.
Leider haben viel zu oft die besten Wissenschaftler keine Ahnung, was ihre Taten bewirken. Das trifft auch auf Technologen und Biologen, wie Gentechniker zu. Diese freuen sich über Teilerfolge, wie zum Beispiel, wenn sie es geschafft haben, Gene von einer Art auf eine andere zu übertragen. Jedoch diese sehr beschränkte Sicht auf die Petrischale entspricht nicht der Sicht auf die Welt. Zellen in einer Petrischale kennen keine echten Pflanzen, keinen echten Erdboden, sie haben keine Beziehung zu echten Menschen, deren Leben sie jedoch zerstören könnten.
Menschen in Demokratien genießen Rede- und Meinungsfreiheit, Recht auf Persönlichkeit und Privatsphäre und das Versammlungs- und Vereinigungsrecht. Darüber hinaus haben sie das Recht, Oberhäupter abzuwählen, die sie nicht wollen, und andere zu wählen. Demgegenüber haben jedoch Angestellte derartige Rechte nur äußerst selten. Stattdessen unterstehen sie einer strikten Hierarchie und werden streng überwacht. Das Recht auf Arbeit bedingt häufig, dass auf Bürgerrechte verzichtet werden muss, weil in der Wirtschaft es gar keine echte Demokratie gibt. Dort gibt es eher nichts, was man annähernd als demokratisch bezeichnen könnte. In typischen Konzernen sind es die Eigentümer, die ganz oben in der Konzernhierarchie, die Entscheidungen treffen, und ihren Willen einem Gesetzstatus verleihen. Über die Konzernhierarchie entwickeln sich zum Teil tiefgreifendende Kontrollmechanismen, die am Ende sogar Situationen des täglichen Lebens vorschreiben. Als Angestellter folgen Sie im Prinzip Vorschriften und Strukturen, die andere vorgeben, und übernehmen Arbeiten, bei der Sie kaum Einfluss auf das haben, was Sie machen, oder die Umstände, unter denen sie es machen. In diesem Bereich der Wirtschaft können Sie nicht darüber diskutieren. Wenn es eine ehrliche Diskussion darüber gäbe, wie viel Einfluss ein Einzelner hat, dann würde das Ganze völlig korrupt erscheinen.
Das Bildungs- und Arbeitssystem verlangt nicht, dass man seine Ideologie verinnerlicht. Es verlangt nur, dass man ideologisch diszipliniert ist. Das bedeutet, bei der Arbeit wird sich an die Ideologie des Arbeitgebers gehalten.
In einem Unternehmen kann den ganzen Tag ein Produkt beworben werden, und gleichzeitig erzählen Sie ihren Freunden zu Hause, dass es Murks ist und sie es besser nicht kaufen sollten. Das passiert zwar nicht oft, was etwas mit dem Stockholm-Syndrom zu tun haben könnte. Dieser Name stammt von einem Vorfall in Schweden, wo Bankräuber mehrere Menschen über eine lange Zeit als Geiseln nahmen. Als die Geiselnehmer die Geiseln dann am Ende freiließen, äußerten sich die ehemaligen Geiseln sehr positiv über die bewaffneten Bankräuber, die sogar gedroht hatten sie – die Geiseln - umzubringen. Auch wenn das seltsam klingt, ist es eine einfache Psychologie, die einem scheinbar sicheren Weg folgt. Hierbei geht es um eine Art Überlebenstrieb und Chancenverbesserung, um nicht umgebracht zu werden. Die Opfer identifizierten sich mit den Tätern, die über ihr Leben entscheiden können. Bei der Arbeit passiert oft dasselbe. Hierbei erscheint der sicherste Weg, die Ideologie des Arbeitgebers zu verinnerlichen.
Im Laufe eines Lebens wird einem klar, das man sich, wenn man überleben will, den gegebenen Strukturen anpassen muss. Wenn man eine Arbeit, eine Karriere will, muss man dem Arbeitgeber gefallen. Also, wenn man sich mit anderen verstehen will, muss man diesen Menschen zeigen, dass man ihr Leben nicht stören wird. Diese Regel führt letztendlich dazu, dass die vorgegebene Struktur zunehmend interessanter für einen wird.
Ideologische Übereinstimmungen werden oft als politisch neutral betrachtet. Wenn zum Beispiel jemand sich der dominanten Ideologie nicht anpasst, die ein Arbeitgeber vorgibt, dann sagt das Umfeld: „Der wird jetzt aber politisch.“. Hierbei wird jedoch komplett außen vorgelassen, dass jeder bereits politisch ist, wenn der Ideologie des Arbeitgebers gefolgt wird. Wenn Menschen Tag und Nacht, Tag für Tag und Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr arbeiten, um den Status quo zu behalten, ist es schwierig, diese als unpolitisch zu betrachten. Eine hierarchische Arbeitswelt verlangt, dass man nicht nur seine Zeit und sein Wissen verkauft, sondern sie verlangt zudem, dass wir unseren Gehorsam verkaufen. Je besser jemand sich der Logik des Systems anpasst und den Zielen der Vorgesetzten folgt, desto mehr Macht wird er bekommen.
Teil III, am 19. August 2022