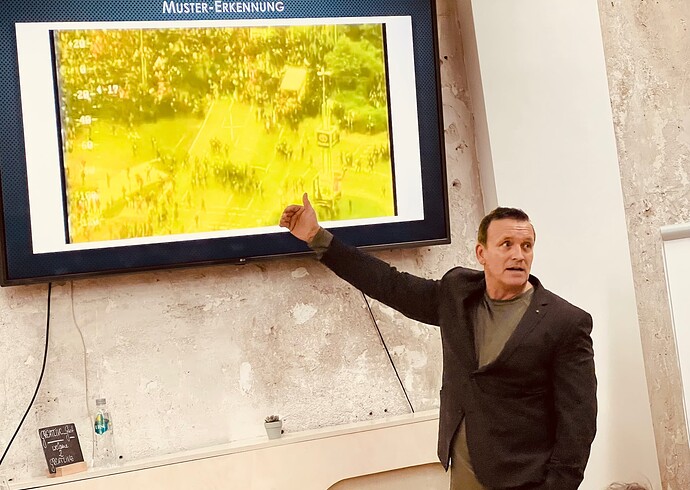Vorweg: Meine Kritik ist nicht als Anklage, sondern als Anstoß zur Diskussion gedacht.
Warum die CDU mit Friedrich Merz wohlmöglich in ein enormes Risiko läuft – und was das für Deutschland bedeutet
Friedrich Merz steckt in einem politischen Dilemma, das man getrost als Dreifrontenkrieg bezeichnen könnte. Das Risiko, das er eingeht, könnte so peinlich werden, dass er am Ende den Berliner Bunker braucht, um der öffentlichen Schmach zu entkommen. Doch warum? Sein Billionen-Schulden-Plan hat das Potenzial, Deutschland nicht nur finanziell, sondern auch politisch an den Rand des Abgrunds zu bringen.
Die erste Front: Verfassungsgerichtsklagen und politische Querelen
Merz’ Plan, ein Sondervermögen für Rüstung und Ukraine-Hilfe aufzulegen, stößt auf massiven Widerstand – nicht nur in der Opposition, sondern auch innerhalb der Ampel-Koalition. Die AfD und die Linke haben bereits angekündigt, weitere Verfassungsklagen einzureichen. Auch wenn die ersten Klagen BVerfG abgewiesen wurden und der Termin wenige Tage vor dem Einführen der neuen Bundesregierung nun doch stattfinden kann, um etwas zu beschließen, wofür es nach der Einführung der neuen Bundesregierung und neuen Zusammensetzung des Bundestags aller Wahrscheinlichkeit nach keine Mehrheit geben würde. Doch das ist nur der Anfang.
Interessanterweise weigern sich sogar die Grünen, Merz’ Pläne zu unterstützen – obwohl der ursprüngliche Vorschlag von Robert Habeck und Co. stammt. Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ließ verlauten: „Wenn ich mir den Bereich Sicherheit, Frieden und Verteidigung ansehe, dann springt auch dieser Bereich komplett zu kurz. Diesen Gesetzentwurf werden wir keine Zustimmung erteilen.“
Doch wo waren diese Bedenken in den letzten vier Jahren? Deutschland galt lange als Anker der Stabilität in Europa, vor allem wegen der Schuldenbremse. Investoren vertrauten darauf, dass Deutschland nicht über seine Verhältnisse lebt. Doch jetzt könnte dieses Vertrauen bröckeln – mit fatalen Folgen.
Die zweite Front: Schulden, Zinsen und die tickende Zeitbombe
Merz’ Plan sieht vor, Staatsanleihen im Wert von bis zu 1 Billion Euro auszugeben. Doch hier liegt der Haken: Es handelt sich nicht um ein „Sondervermögen“, wie oft behauptet wird, sondern um echte Schulden, für die der Steuerzahler haftet.
Nehmen wir an, die Zinsen für diese Anleihen liegen bei 2,5 %. Das bedeutet, dass allein die Zinslast pro Jahr 25 Milliarden Euro betragen würde. 25 Milliarden, die jedes Jahr vom Steuerzahler aufgebracht werden müssen – ohne Garantie, dass die gesamten Ausgaben einen Mehrwert für die Bevölkerung bringen.
Denn das Geld fließt vor allem in Rüstungsgüter, die in die Ukraine geliefert werden. Doch was, wenn diese Güter am Ende zerstört werden? Was, wenn der Konflikt sich noch Jahre hinzieht, wie BND-Präsident Bruno Kahl warnte? Dann bleibt Deutschland auf einem Schuldenberg sitzen, der immer weiter wächst. [Deutscher Geheimdienst-Chef warnt vor düsterem Putin-Plan: „Russland will uns testen“]
Die dritte Front: Der Finanzmarkt und das Misstrauen der Investoren
Der Finanzmarkt hat bereits reagiert. Investoren rechnen damit, dass die Zinsen für deutsche Staatsanleihen steigen werden – und haben begonnen, ihre Portfolios umzuschichten. Long-Investitionen auf steigende Zinsen sind bereits im Gange, was den Wert bestehender Anleihen drückt.
Sollte Merz’ Plan scheitern, könnte dies zu einem Crash am Anleihenmarkt führen. Doch selbst wenn er erfolgreich ist, muss er noch den Bundesrat überzeugen – und dort sitzen Politiker wie Hubert Aiwanger, die kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es um verantwortungslose Schuldenpolitik geht.
Die Notwendigkeit einer starken Verteidigung – aber effizient und ethisch
Es ist unbestreitbar, dass Europa und insbesondere Deutschland eine starke Verteidigung benötigen. Eine marode Bundeswehr hilft niemandem – weder den Bürgern noch den Verbündeten. Doch die Frage ist: Wie kann eine solche Verteidigung effizient, ethisch vertretbar und zukunftsfähig gestaltet werden?
Abbau von Bürokratie und Mikromanagement
Ein großes Problem der Bundeswehr ist die überbordende Bürokratie und das Mikromanagement, das Innovationen und schnelle Entscheidungen blockiert. Hier braucht es dringend Reformen, um die Agilität und Handlungsfähigkeit der Streitkräfte zu verbessern.
- Effizienzsteigerung: Durch den Abbau von bürokratischen Hürden könnten Ressourcen besser genutzt und schneller auf neue Bedrohungen reagiert werden.
- Technologische Integration: Moderne Technologien wie KI, Drohnen und Cybersicherheit sollten stärker genutzt werden, um die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen, ohne dabei Menschenleben unnötig zu gefährden.
Technologie, die schützt – statt tötet
Die Zukunft der Verteidigung liegt in intelligenten Systemen, die präventiv wirken und Konflikte vermeiden, anstatt sie zu eskalieren. Hierzu gehören:
- Defensivtechnologien: Systeme, die Angriffe abwehren können, ohne selbst aggressiv zu sein.
- Frühwarnsysteme: Technologien, die Bedrohungen frühzeitig erkennen und deeskalierende Maßnahmen ermöglichen.
- Humanitäre Ausrichtung: Eine Verteidigungspolitik, die den Schutz von Zivilisten in den Mittelpunkt stellt und auf minimale Kollateralschäden abzielt.
Die perfide Masche: NGOs, Wirtschaft und politische Einflussnahme
Doch das ist noch nicht alles. Im Hintergrund spielen sich Szenarien ab, die an einen politischen Thriller erinnern. Es gibt möglicherweise glaubhafte Hinweise darauf, dass bestimmte NGOs, die mit der Rüstungsindustrie verflochten sind, versuchen könnten, über Umwege Einflussauf politische Entscheidungen zu nehmen.
Falls dies zutreffen sollte, würde dies nicht nur gegen demokratische Prinzipienverstoßen, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Politik weiter untergraben. Besonders bedenklich ist die mögliche Rolle von Wrap-up-smear-Strategien, bei denen Kritiker medial und existenziell vernichtet werden sollen. Namen wie Nancy Faeser und Robert Habeck werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt.
Was bedeutet das für die Bürger?
Die langfristigen Auswirkungen von Merz’ Plänen könnten verheerend sein. Steuererhöhungen, Kürzungen bei Sozialleistungen und eine schwächelnde Wirtschaft wären nur einige der möglichen Folgen. Doch das größte Risiko ist der Vertrauensverlust in die Politik – und in den Staat selbst.
Was ist eine NGO?
Eine NGO, oder Nichtregierungsorganisation, ist per Definition ein gemeinnütziger Verein, der im Interesse des allgemeinen Gemeinwohls handelt. Ihr Ziel ist es, der Öffentlichkeit überparteilich und überpolitisch zu dienen. Das bedeutet, dass jeder davon profitieren sollte – unabhängig von politischer Ausrichtung, sozialem Status oder anderen Kriterien. NGOs sollen keine Interessenvertretung für bestimmte Parteien oder politische Gegner sein.
Doch hier beginnt das Problem: NGOs genießen steuerliche Privilegien. Sie zahlen keine Umsatzsteuer, keine Gewinnsteuer – nichts. Ihre Aktivitäten werden lediglich alle fünf Jahre daraufhin überprüft, ob sie noch als gemeinnützig gelten. Personal kann eingestellt werden, und die Gehälter der Mitarbeiter werden zwar versteuert, doch die Gehälter der Geschäftsführer können sich an denen der freien Wirtschaft orientieren. Das wirft die Frage auf: Wie gemeinnützig ist eine Organisation, deren Führungskräfte möglicherweise sechsstellige Beträge verdienen?
Finanzierung: Spenden und staatliche Fördertöpfe
Die Finanzierung von NGOs erfolgt hauptsächlich über Spenden und staatliche Fördermittel. Letztere sind es, die besonders kritisch betrachtet werden müssen. Hier geht es um Summen in Milliardenhöhe, die aus Steuergeldern stammen. Es liegt möglicherweise nahe, dass diese Gelder nicht ohne politische Zweckbindung vergeben werden.
Ein Blick auf die engen Verbindungen zwischen NGOs und Ministerien lässt aufhorchen. Regelmäßige Besuche von NGO-Vertretern in Ministerien und sogar im Kanzleramt werfen Fragen nach der Unabhängigkeit dieser Organisationen auf. Ein besonders brisantes Beispiel ist der Fall des Recherchekollektivs Correctiv, das im Zusammenhang mit einer Veranstaltung am Wannsee falsche Behauptungen über angebliche Zwangsdeportationen verbreitete. Obwohl Gerichte mittlerweile bestätigt haben, dass es derartige Äußerungen nie gegeben hat, wurde das Narrativ von regierungsnahen NGOs und der Regierung selbst weiter als Fakt dargestellt.
Die Rolle der NGOs: Gemeinnützigkeit oder politische Instrumentalisierung?
Hier liegt der Kern des Problems: NGOs erhalten direkte Förderungen von Ministerien, weil sie sich als gemeinnützig darstellen. Gleichzeitig werden Gehälter gezahlt, die von Steuergeldern finanziert werden. Das wirft die Frage auf, wie gemeinnützig diese Organisationen tatsächlich sind. Sollte nicht das Wohl aller im Vordergrund stehen, und nicht das Interesse einzelner politischer Akteure?
Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Urteilen klargestellt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um den Status der Gemeinnützigkeit zu behalten. So heißt es in einem Urteil vom 22. Februar 2011 (BVerfG, 1 BvR 669/06): „Bürgerschaftliches Engagement muss nicht politisch neutral sein; es steht jedem Bürger frei, sich politisch einseitig zu positionieren. Der Staat hingegen muss im politischen Wettbewerb der Parteien Neutralität wahren und die Chancengleichheit der Parteien achten.“
In einem weiteren Urteil vom 15. Juni 2022 (BVerfG, 2 BvE 4/20, 2 BvE 5/20) betont das Gericht, dass der Staat keine Organisationen durch Steuerbegünstigungen fördern darf, die sich nicht parteipolitisch neutral verhalten. Im Klartext bedeutet das: NGOs dürfen weder für noch gegen eine bestimmte Partei agieren, ohne ihren Anspruch auf Überparteilichkeit und Gemeinnützigkeit zu gefährden.
Wenn Steuergelder zur Bekämpfung der Opposition missbraucht werden
Wenn Steuergelder von der Regierung an NGOs vergeben werden, um die politische Opposition zu bekämpfen, dann ist dies nicht nur verfassungswidrig, sondern auch zutiefst demokratiefeindlich – selbst wenn sich die Akteure selbst als „Demokratieschützer“ inszenieren. Es sei daran erinnert, dass auch die DDR behauptete, demokratischer zu sein als der Westen, und sogar das Wort „Demokratie“ in ihrem Namen trug. Doch der Schein trügt: Wenn eine Regierung Steuergelder einsetzt, um oppositionelle Kräfte zu unterdrücken, verstößt sie gegen grundlegende demokratische Prinzipien.
Dies gilt auch dann, wenn die Regierung nicht direkt, sondern über eine NGO handelt, der sie die Gelder zur Verfügung stellt. Allein die Tatsache, dass eine Organisation staatliche Mittel erhält, um parteipolitische Ziele zu verfolgen, erfüllt den Tatbestand des Missbrauchs. In solchen Fällen muss den betroffenen NGOs sofort die Gemeinnützigkeit entzogen werden.
Spenden mit politischer Zweckbindung
Doch nicht nur staatliche Fördermittel sind problematisch. Auch Spendengelder, die unter der Bedingung vergeben werden, parteipolitische Aktivitäten umzusetzen, die der Opposition schaden, sind höchst fragwürdig. Solche Spenden dienen nicht dem Gemeinwohl, sondern verfolgen klare politische Interessen. Sollte festgestellt werden, dass eine NGO Gelder entgegen ihrer gemeinnützigen Satzung für parteipolitische Zwecke eingesetzt hat, müsste sie diese Gelder für den gesamten Zeitraum zurückzahlen.
NGOs als Schleusen zur illegalen Bereicherung
Fakt ist: NGOs können – oder sind möglicherweise in manchen Fällen bereits – eine Schleuse zur illegalen Bereicherung. Wenn staatliche Gelder in Milliardenhöhe an Organisationen fließen, die sich als gemeinnützig ausgeben, aber tatsächlich politische Ziele verfolgen, dann wird das System missbraucht. Ein besonders eklatantes Beispiel hierfür war der Einsatz von NGOs im Wahlkampf gegen Friedrich Merz, bei dem Gelder offenbar dazu verwendet wurden, die Opposition zu diskreditieren.
Die Konsequenzen: Transparenz und Rechenschaftspflicht
Es ist dringend notwendig, dass die Vergabe von Steuergeldern an NGOs transparenter und strenger kontrolliert wird. Jeder Cent, der aus öffentlichen Mitteln fließt, muss dem Gemeinwohl dienen – und nicht parteipolitischen Interessen. Sollte eine NGO nachweislich gegen diese Prinzipien verstoßen, müssen die Konsequenzen klar und unmissverständlich sein: der Entzug der Gemeinnützigkeit, die Rückzahlung missbräuchlich verwendeter Gelder und gegebenenfalls strafrechtliche Ermittlungen.
Die Strategie des „Wrap-Up-Smear“ – Verpackter Rufmord
Die Taktik des „Wrap-Up-Smear“ – zu Deutsch etwa „verpackter Rufmord“ – ist eine perfide Strategie, die gezielt eingesetzt wird, um politische Gegner zu diskreditieren. Nancy Pelosi, eine prominente Vertreterin der US-Demokraten, hat diese Methode offen erklärt (Quelle: YouTube). Sie beschreibt es so: „Du beleidigst jemanden mit Lügen und Unwahrheiten, bewirbst diese in den Medien, und wenn du dann darüber schreibst, sagst du: ‚Wie man in der Presse lesen konnte, bist du ein …‘. So erhält deine Lüge eine offizielle Bestätigung, weil die Presse über den Rufmord berichtet hat. Dann bewerbe ich die Presseberichte über die Rufmord-Lüge, die wir erfunden haben. Das ist die Taktik.“
Diese Methode mag vielen bekannt vorkommen. Sie funktioniert, weil die meisten Menschen Medienberichten vertrauen und selten hinterfragen, woher die Informationen stammen. Wenn der Verfassungsschutz oder andere Institutionen ihre Einstufungen nicht auf Fakten, sondern auf solche politisch motivierten Taktiken stützen, wird die Lüge mit Macht und Durchschlagskraft ausgestattet. Besonders anfällig für solche Strategien sind Menschen, die sich einseitig informieren oder emotional vulnerabel sind. Wer es wagt, diese Narrative zu hinterfragen, riskiert selbst zum Opfer einer solchen Kampagne zu werden.
Die Rolle der NGOs und Medien
NGOs sind besonders empfänglich – oder gefährdet –, sich solche Strategien wie den „Wrap-Up-Smear“ anzueignen. Sie starten Kampagnen, die dann von Medien, die oft ebenfalls mit Steuergeldern finanziert werden, verbreitet werden. Die Regierungsparteien nutzen diese medial aufgegriffenen Themen, um sie politisch zu instrumentalisieren. Sie geben vor, die Berichte seien unabhängige Enthüllungen, und nutzen sie als Anlass, die Opposition öffentlich zu kritisieren und zu bekämpfen.
Ein typisches Muster sieht so aus: „Wie wir in den Medien lesen konnten, spiegeln diese Berichte wider, dass wir geschlossen gegen diese … vorgehen müssen.“ Auf diese Weise wird die Opposition geschwächt, während die NGOs weiterhin Steuergelder von der begünstigenden Regierung erhalten. Dieser Kreislauf wird nur durchbrochen, wenn die Gier einzelner Vertreter oder ihrer Mittelsmänner offengelegt wird.
Immobilienprojekte und Abhängigkeiten
Ein besonders brisantes Beispiel sind Immobilienprojekte, die möglicherweise mit staatlichen Geldern finanziert und an NGOs weitergegeben werden. Diese NGOs vermieten die Immobilien dann an Mieter, deren Mieten von der öffentlichen Hand bezahlt werden. Solche Projekte machen die NGOs abhängig von weiteren Fördergeldern und Spenden. Sollte diese Finanzierung ausbleiben, droht das gesamte System wie ein Schneeball zusammenzubrechen.
Der Weg zur kriminellen Diktatur?
Diese Praktiken werfen die Frage auf, ob wir uns möglicherweise auf dem Weg zu einer kriminellen Diktatur befinden. Friedrich Merz, der selbst Opfer solcher Kampagnen wurde, hat dies deutlich gemacht. Während der letzten Bundestagswahl im Dezember 2024 waren plötzlich zahlreiche regierungsfinanzierte NGOs aktiv, um gegen die CDU und insbesondere gegen Merz vorzugehen. Sie verbreiteten Vorwürfe, organisierten Demonstrationen und behaupteten, Merz sei ein Nazi. Sogar Parteizentralen wurden gestürmt und besetzt – alles basierend auf organisierten Protesten, die durch „Wrap-Up-Smear“-Strategien angeheizt wurden.
Kritik ohne Unterstellungen
Es geht hier nicht darum, NGOs pauschal zu verdächtigen. Viele Organisationen leisten wertvolle Arbeit, und es ist möglich, dass alle NGOs tatsächlich gemeinnützig sind. Doch es ist notwendig, kritisch zu hinterfragen, wie Gelder verwendet werden. Ein Beispiel ist die LGBTQ-Förderung, bei der Millionen ins Ausland fließen, ohne dass die Wirkung dieser Ausgaben messbar wäre. Deutschland gibt hier überproportional viel aus, oft ohne nachvollziehbare Ergebnisse.
Noch einmal: Es geht nicht um Unterstellungen oder Hausdurchsuchungen, sondern um Transparenz und Rechenschaftspflicht. Wenn Steuergelder in Milliardenhöhe fließen, muss sichergestellt sein, dass sie tatsächlich dem Gemeinwohl dienen – und nicht politischen oder persönlichen Interessen.
Correctiv – Ein Paradebeispiel für „Wrap-Up-Smear“?
Die Berichterstattung von Correctiv über die sogenannte „Wannseekonferenz 2.0“ könnte möglicherweise ein Paradebeispiel für die Anwendung der „Wrap-Up-Smear“-Strategie sein – zumindest wirft sie erhebliche Fragen auf. Ich selbst war damals geschockt, als ich die ersten Presseberichte über diese angebliche Geheimkonferenz hörte. Die Empörungswelle, die daraufhin über NGOs, Medien, Regierung und schließlich die Bevölkerung hereinbrach, war enorm.
„Correctiv enthüllt: Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland“ – so lautete die Schlagzeile, die am 17. Januar 2024 in einem Livestream aus dem Berliner Ensemble verbreitet wurde. Angeblich hätten sich AfD- und CDU-Politiker getroffen, um über Massenabschiebungen und Zwangsdeportationen zu diskutieren. Laut Correctiv – damals zumindest, denn mittlerweile wurde diese Behauptung zurückgenommen – habe man sogar darüber gesprochen, wie man Deutsche mit Migrationshintergrund (also Menschen mit deutschem Pass) abschieben könne. Wäre dies wahr gewesen, hätte es sich um einen monumentalen Skandal gehandelt.
Die mediale und politische Reaktion
Die Berichte wurden sofort im Bundestag aufgegriffen. Mit vorauseilendem Gehorsam wurden Sicherheitsbehörden aktiviert, und sogar Marine Le Pen kündigte ihre Beziehungen zur AfD an. Medien wie ZDF und NDR berichteten im Gleichklang, ohne die Beweise zu prüfen. Dementis wurden als Schutzbehauptungen abgetan, ohne dass sich die Mühe gemacht wurde, die Aussagen zu überprüfen. Das Narrativ reichte aus, um eine breite Empörungswelle auszulösen, die bis heute nachhallt. Viele Menschen waren überzeugt, dass die AfD und Teile der CDU mit dem Dritten Reich vergleichbar seien.
Die Rolle von Correctiv und die Verpflichtung zur Wahrheit
Das Brisante daran ist, dass Correctiv in seinen Statuten festhält: „Bekämpfung von Desinformation: Über Fact-Checking-Initiativen und internationale Netzwerke“ sowie „Förderung der Volks- und Berufsbildung: Durch journalistische Berichte.“ Diese Verpflichtungen gelten auch für die öffentlich-rechtlichen Medien, die sich der Fakteninformation verpflichtet haben. Für einen Großteil der Bevölkerung ist dies eine Bestätigung der Berichterstattung, was möglicherweise das Versagen in diesem Fall besonders schwerwiegend erscheinen lässt.
Doch dann kam vor Gericht in Hamburg heraus, dass die Behauptung, Deutsche mit Migrationshintergrund sollten abgeschoben werden, nicht stimmte. Die Verteidigung von Correctiv und ZDF lautete daraufhin, dass diese Aussage auf der Basis freier Meinungsäußerung beruhe. Mit anderen Worten: Ein gemeinnütziger Verein verbreitet eine Unwahrheit, Medien und Regierung springen darauf an, und dann wird die falsche Behauptung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung gerechtfertigt.
Die Folgen für die Opposition
Fakt ist: Es handelte sich um eine unwahre Tatsachenbehauptung, die von den Zuschauern als Fakt wahrgenommen wurde, weil sie von Journalisten verbreitet wurde. Mit dieser Kampagne wurde die Opposition vorsätzlich in der Öffentlichkeit diskreditiert. Die Frage nach dem Gemeinwohl stellt sich hier mehr denn je: Wie kann eine Organisation, die sich der Bekämpfung von Desinformation verschrieben hat, selbst Desinformation verbreiten?
Merz und die Folgen
Friedrich Merz reagierte auf diese Vorgänge mit über 500 Fragen an die Bundesregierung, auch wenn hinter verschlossenen Türen von einer weiteren Verfolgung dieser Praktiken möglicherweise abgesehen wurde. Es bleibt abzuwarten, ob mutige Juristen diese Praktiken vor Gericht bringen werden.
Ein weiteres Beispiel ist das Abstimmungsverhalten im Bundestag, bei dem Merz beinahe mit den Stimmen der AfD einen Antrag durchgebracht hätte. In der öffentlichen Wahrnehmung führte dies dazu, dass NGOs alles mobilisierten, um mit Protesten und Aktionen gegen die Opposition vorzugehen. Auch hier stellt sich die Frage: Wie hoch ist das Allgemeinwohl bei solchen Aktivitäten, wenn die Mehrheit der Bevölkerung die damaligen Aktivitäten von Merz und der CDU unterstützt hätte?
Steuergelder und politische Instrumentalisierung
Unsere Meinung ist klar: Es darf nicht sein, dass eine Regierung NGOs finanziert, die gegen die Interessen der Gemeinnützigkeit handeln. Eine Regierung darf keine Gelder an Organisationen vergeben, die darauf abzielen, politische Gegner zu diskreditieren oder der Regierung selbst Vorteile zu verschaffen.
Die Correctiv-Affäre zeigt, wie gefährlich es ist, wenn Steuergelder für politische Kampagnen missbraucht werden. Sie zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Medien und NGOs ihrer Verantwortung gerecht werden und sich nicht zum Werkzeug politischer Interessen machen lassen.
Die Frage bleibt: Wer kontrolliert die Kontrolleure? Und wie können wir sicherstellen, dass öffentliche Gelder tatsächlich dem Gemeinwohl dienen – und nicht politischen oder persönlichen Interessen?
Das System der NGOs: Ein Spiel mit Steuergeldern und Macht
Wenn Sie heute eine NGO gründen, können Sie sich und Ihren Mitarbeitenden Gehälter auszahlen – und das ist besonders lukrativ, wenn Sie enge Beziehungen zu den Parteien haben, die gerade an der Regierung sind. Hier kommt der sogenannte „Ashraf-Hakimi-Trick“ ins Spiel: Der marokkanische Fußballspieler Hakimi hat sein gesamtes Vermögen auf seine Mutter übertragen, um bei einer Scheidung seiner Frau keinen Zugriff auf sein Vermögen zu gewähren. Ähnlich könnte es bei NGOs funktionieren: Ein Politiker oder dessen Verwandter, Freund oder Bekannter wird als Geschäftsführer in eine NGO eingesetzt, um sicherzustellen, dass die politisch zweckgebundenen Fördergelder letztlich den eigenen Interessen zugutekommen.
Offiziell ist alles gemeinnützig, aber dahinter könnten sich Abhängigkeiten und persönliche Bereicherung verbergen. Gehälter werden an Verwandte, Freunde oder Bekannte gezahlt, um die eigenen Interessen zu wahren. Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos: Projekte auf der ganzen Welt können finanziert werden, ohne dass jemand die Wirkung misst oder bewertet.
Beispiel: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO)
Die DGO ist der größte Verband für Osteuropaforschung im deutschsprachigen Raum und fördert interdisziplinäre Forschung sowie den Dialog zu Politik, Wirtschaft und Kultur in Osteuropa. Sie ist gemeinnützig und erhält institutionelle Förderung vom Auswärtigen Amt. Doch die Beweise für den tatsächlichen Nutzen solcher teuren Aktivitäten sind oft dürftig. Ein Faktencheck vor Ort könnte ernüchternde Ergebnisse liefern, die nicht annähernd dem entsprechen, was an Geldern in diese Projekte geflossen ist.
Hinter Slogans wie „Wir haben die Demokratie oder das Klima in Peru, China, Tadschikistan (fiktive Beispiele) gefördert“ verbirgt sich oft nur ein plakativer Wert, aber kein materieller, nachweisbarer Nutzen. Nicht selten finden sich in diesen Ländern zwielichtige Empfänger der Gelder, bei denen der Verdacht aufkommt, dass die Mittel anderen Zwecken gedient haben könnten.
Die fehlende Kontrolle
Eine NGO muss keine Angst vor dem Finanzamt haben, da sie keine Steuern zahlt. Die Überwachung der Rechtsmäßigkeit ihrer Aktivitäten lässt enorm viel Spielraum. Es wäre nicht überraschend, wenn sich dieses System – oder diese hypothetische Darstellung – in der Realität als ein riesiger Schneeball der Ernüchterung entpuppt. Kommt einen möglicherweise bekannt vor - CumEx, CumCum, Wirecard, …?
Paco Bay packt aus
Als Ermittler und Ex-Agent schreibe ich Thriller, die auf realen Erfahrungen basieren und in fiktive Geschichten verpackt sind. Diese Geschichten halten einige Ernüchterungen und Enttäuschungen bereit. Doch das Gute an einer Enttäuschung ist, dass die Täuschung endet – Ent-Täuschung.
Zum Schluss: Ein System, das Fragen aufwirft
Das NGO-System in Deutschland wirft mehr Fragen auf, als es Antworten liefert. Die milliardenschweren Fördermittel, die engen Verbindungen zu politischen und wirtschaftlichen Akteuren und die fehlende Transparenz bei der Verwendung von Steuergeldern lassen Zweifel an der Unabhängigkeit und Gemeinnützigkeit vieler Organisationen aufkommen.
Sollte man nicht dieses System einer kritischen Prüfung unterziehen? Denn eines ist klar: Wenn NGOs ihre privilegierte Stellung missbrauchen, um politische Interessen zu vertreten oder persönliche Bereicherung zu betreiben, dann läuft dies dem eigentlichen Zweck ihrer Existenz zuwider – dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen.
Die Frage, die über allem steht, bleibt: Wie gemeinnützig sind diese Organisationen wirklich? Die Antwort darauf könnte ein Skandal sein, der das Vertrauen in das System nachhaltig erschüttern würde.
Paco Bay
Quellen & Recherchen:
- Schuldenbremse und Finanzpolitik:
- Rüstungsexporte und Ukraine-Hilfe:
- NGOs und politische Einflussnahme:
- Zinsen und Finanzmarkt:
Über Paco Bay – Die Mission hinter den Thrillern
Mein Name ist Paco Bay – ein Pseudonym, das mir als Autor, ehemaliger Ermittler und Profiler die Möglichkeit gibt, Geschichten zu erzählen, die sonst im Verborgenen bleiben würden. Mit über 1.000 Einsätzen weltweit, Erfahrungen im Nachrichtendienst, in Spezialeinheiten und als Analyst kenne ich das Gewicht der Geheimnisse, die nicht ausgesprochen werden dürfen, aber sollten.
Meine Thriller sind fiktiv, doch sie basieren auf realen Bezügen und möglichen Ereignissen, die ich in meiner Laufbahn erlebt, analysiert oder erfahren habe. Mein Motiv ist es, anderen Whistleblowern und Geheimnisträgern, die sich nicht trauen können, ihre Stimme zu erheben, eine Plattform zu bieten. Unter dem Namen Paco Bay verpacke ich ihre Geschichten in fiktive Romane, die dennoch die Essenz realer Ereignisse und systemischer Probleme widerspiegeln.
Als Profiler und Ermittler habe ich gelernt, Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu analysieren und die Wahrheit hinter den Fassaden zu suchen. Diese Fähigkeiten fließen in meine Bücher ein, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen sollen. Es geht mir nicht darum, konkrete Personen oder Organisationen anzuprangern, sondern vielmehr darum, gesellschaftliche und politische Mechanismen kritisch zu hinterfragen und aufzuklären.
Meine Bücher sind Thriller – unterhaltsam, spannend und fiktiv. Doch sie enthalten auch Elemente, die auf belegbaren oder möglichen Ereignissen beruhen. Sie sollen Diskussionen anstoßen und vor allem denen eine Stimme geben, die im Schatten der Macht keine haben.
Ich bin kein Aktivist, sondern ein Geschichtenerzähler. Doch ich glaube daran, dass Geschichten die Kraft haben, Veränderung zu bewirken – indem sie Licht auf die Dinge werfen, die im Dunkeln bleiben sollen.
Paco Bay packt aus – nicht als Ankläger, sondern als Autor, der die Welt durch die Linse des Thrillers betrachtet und dabei die Grenzen zwischen Fiktion und Realität bewusst verschwimmen lässt.